Krebs und Cringe: Krankenzimmer und ihre seltsame Öffentlichkeit
Ich habe eine Krebstherapie begonnen und versuche mich hier an einer Art Tagebuch darüber. Es geht um Gedanken zur Behandlung, zu Krankenhausaufenthalten und Krebs im Allgemeinen.
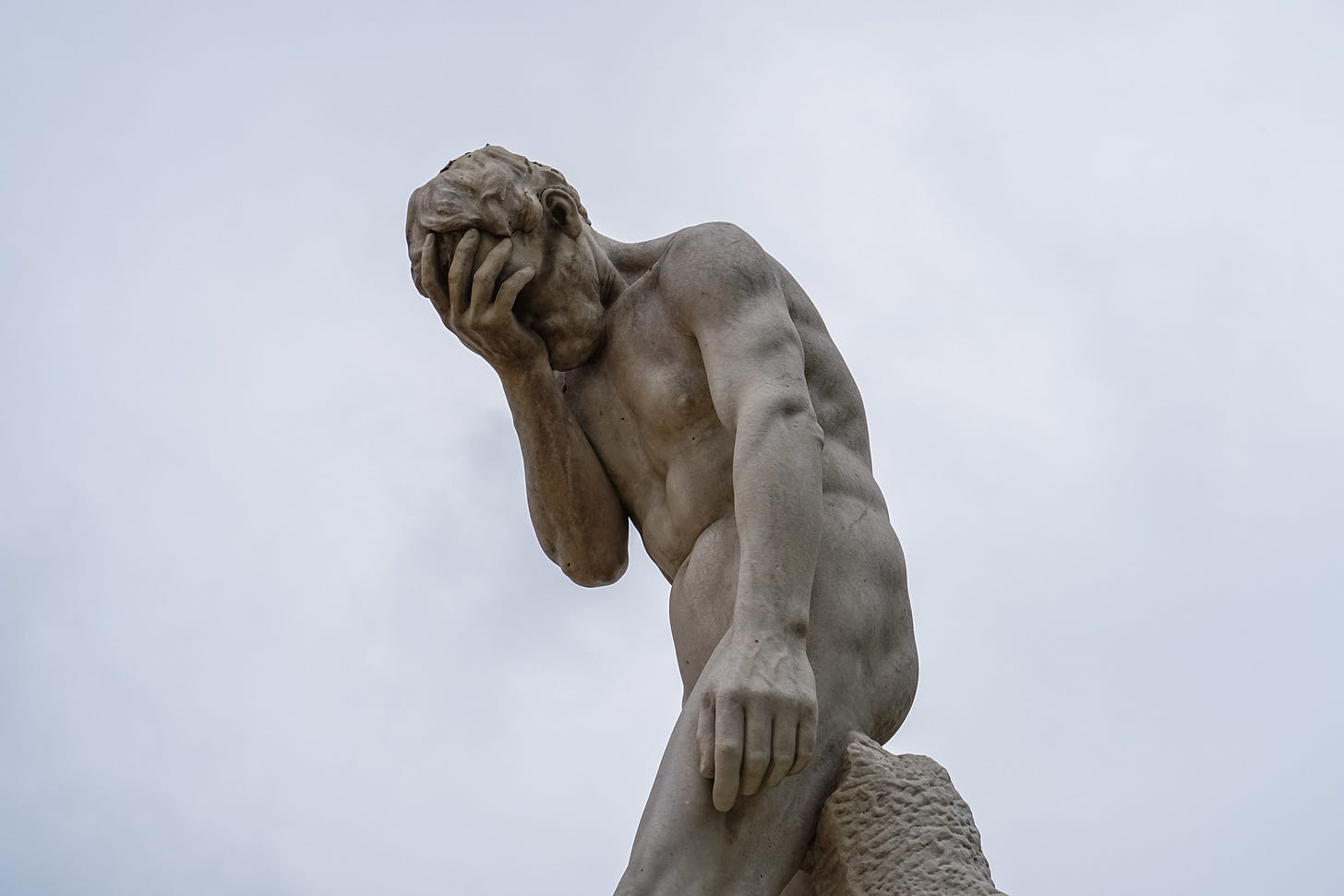
Vor einiger Zeit wurde bei mir chronisch-lymphatische Leukämie (CLL) festgestellt. Nachdem sich meine Blutwerte verschlechterten und Lymphknoten vor allem im Halsbereich weiter anschwollen, habe ich im Januar 2022 eine Chemotherapie begonnen.
Als eine Art Tagebuch begleitet diese kleine Text-Sammlung die Therapie – zumindest solange, wie ich das für eine gute Idee halte. Es geht um Eindrücke von der Behandlung, Gedanken zum Thema Krebs und Aufenthalte im Krankenhaus. Orts- und Personennamen werden nicht genannt, alles ist anonymisiert. Jeder Eintrag ins Tagebuch ist ein eigener Post. Bisher gibt es:
Juni 2022
Das Hauptmedikament Venetoclax ist nun seit einiger Zeit auf der Zieldosis eingestellt und ich vertrage es gut. Nach dem Termin in der Tagesklinik mit Obinutuzumab-Infusion plagt mich erneut Heißhunger. Als ich nachmittags wieder zuhause bin, bestelle ich eine Pizza und stelle fest: Ich hätte zwei nehmen sollen. Zum Opfer fallen mir stattdessen Brote, Obst und alle Süßigkeiten, die ich noch da habe. Der Antikörper Obinutuzumab will Energie für seine Arbeit gegen den Krebs.
Schwester Doris
Schwester Doris heißt nicht wirklich Doris. Der Name ist ausgedacht und soll ein bestimmtes Lebensalter andeuten, Anfang 50 etwa. Aber es geht um eine echte Person. [1] Um eine, die viel Cringe bringt und um die ich nach Möglichkeit einen Bogen mache, wenn ich in der Tagesklinik bin.
Sofern sich ein Bogen um sie machen lässt, schließlich bin ich in der Klinik nur bedingt mobil und werde mit anderen einer Pflegerin zugeteilt. Doris werde ich dieses Mal nicht zugeteilt, sie ist aber im gleichen Zimmer für andere Patient*innen zuständig und kontrolliert ab und zu auch mein Infusionsgerät, wenn es routinemäßig piept.
Doris könnte übrigens auch ein Mann oder nicht-binär sein. Wie aber wohl vielerorts, kümmern sich auch in dieser Tagesklinik, von Ärzt*innen abgesehen, nur weiblich lesbare Menschen um Kranke. Das Unbehagen, das Doris’ Verhalten bei mir auslöst, hätte ich jedenfalls auch bei einem Mann. Doris könnte auch einen anderen Beruf haben; solche Leute gibt es überall. Nur fallen sie mir hier besonders auf: Als Patient bin ich ein für Stunden meist liegender Zuschauer in einem Theaterstückchen, bei dem Doris öfter auf die Bühne kommt – und dabei leider gerne mal schwurbelt.
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich über Doris überhaupt schreiben soll. Sie direkt anzusprechen und ihr Paroli zu bieten, sei besser, mögen manche einwenden. Aber zum einen steht Doris’ Art für etwas, das weit verbreitet und damit erhöht betextenswert ist, und zum anderen fällt es mir als Patient schwer, den offenen Konflikt mit jemandem wie ihr zu suchen, zumal in einem Krankenzimmer.
Bewundernswert anlasslos
Ja, Pfleger*innen gehören zu den in dieser Gesellschaft und im Kapitalismus am meisten ausgebeuteten Berufsgruppen, keine Frage; der aktuelle Streik an nordrhein-westfälischen Unikliniken zeigt das wieder deutlich. Gleichzeitig hat Doris als Pflegerin jedoch eine Machtposition inne, von der meine Gesundheit und mein Wohlfühlen in der Tagesklinik abhängen. Ohne Pfleger*innen läuft in Kliniken nichts. Sie sind Manager*innen im Kleinen, das eigentlich ziemlich groß ist. Das ist beeindruckend und ich bin froh, dass sie da sind.
An Kliniktagen bin ich stark medikamentiert, deswegen müde-schläfrig und hänge an einer Infusionsnadel. In so einem erschöpft nebligen und anderen ausgeliefertem Zustand kann und will ich nicht übers „Gendern“, eine Impflicht für Pflegekräfte oder Fragen geschlechtlicher Identität reden. Klar, das erwartet auch keine*r, wird jedoch provoziert, wenn jemand krudes Zeug daherredet – zumal eine Autoritätsperson, die sich das professionell verkneifen können müsste.
Doris aber sticht im Job gern solche Themen an, auf eine fast schon bewundernswert anlasslos-beiläufige und schnodderige Weise. Als könnte sie in der Klinik etwas rauslassen, was sie anderswo nicht kann. Menschen am Tropf können sich halt schlechter wehren und sind beim Weglaufen nicht die schnellsten.
Wehren möchte man sich zum Beispiel dann, wenn deinem Namen, hier war es ein wohl aus Osteuropa stammender, attestiert wird, kaum aussprechbar zu sein. „Nummern wären mir lieber“, sagt Doris und scheint zu vergessen, dass da mit benummerten Menschen schon mal was war in Deutschlands düsterer Vergangenheit. Und soweit ich weiß, war das auch für medizinisches Personal keine Sternstunde.
Alles verworten
Manchmal finde ich es – als Twitter-Nutzer bin ich ja eh chronischer Doomscroller und Informationsmasochist – geradezu schade, dass ich sie nur auszugsweise erlebe. Sie ist nicht immer da, wenn ich da bin. Sonst hätte ich vielleicht mitbekommen müssen, wie sie zum Beispiel auch schon das N-Wort benutzt oder der Ukraine geraten haben könnte, sich Putin gefälligst zu ergeben. Ich mag mich sehr irren, habe allerdings das Gefühl, dass man bei Doris recht viele Häkchen machen könnte.
Das hat schnell dazu geführt, dass ich bei jeder ihrer Äußerungen, auch zu eigentlich medizinischen Dingen, fürchte, sie könnte im nächsten Moment wieder ein Fass in meinem müden Kopf aufmachen. Und sie sagt viel, jeder Handgriff ist eskortiert von Sprechsprache, alles muss verwortet werden, halb Selbstgespräch, halb Dialog, wohl immer in der Erwartung, dass andere einsteigen und Gesagtes bestätigen. Ein Mensch gewordenes „Gell?“. Das mag Unsicherheit ausdrücken, rechtfertigt aber kein Schwurbeln und Raunen.
Verschwörungsmythen und Dialekt
Doris schwäbelt leicht, mit einer, so glaube ich herauszuhören, sächsischen Note. Sie schwächselt quasi und hier bestätigt sich wieder: Verschwörungsmythen sind, selbst in kleinen Prisen, für sich schon schlimm genug, werden für mich aber noch unaushaltbarer, wenn sie im akustischen Kleid des Dialekts daherkommen. Das Freundlich-Kumpelhafte, das Dialekte zumindest an der Oberfläche oft ausstrahlen, und ihr häufig weicher Klang tragen zur Verharmlosung von Verschwörungsmythen bei, woisch?
Doris gehört zu der Sorte Menschen, bei denen du einfach nur willst, wenn sie dir im Alltag schon nicht erspart bleiben, dass sie möglichst wenig sagen und inhaltlich dann in ihrer professionellen Rolle bleiben. Damit trete ich nicht für eine Entpolitisierung sozialer Zufallsbegegnungen ein, sondern halte es bloß für angebracht, Verschwörungschwurbel aus Räumen wie Krankenzimmern fernzuhalten. Krebskranke brauchen das nicht, zumindest ich nicht. Und als Risikogruppe mögen Krebskranke in der Regel auch nicht, wenn Pflegekräfte finden, nicht gegen Covid geimpft sein zu müssen. Das macht sie nämlich zu einer potentiell tödlichen Gefahr für viele Krebskranke.
Seltsam öffentlich
Bezeichnend ist dieses Mal auch, dass sich Doris mit einem anderen Klinik-Mitarbeiter zofft, der einen herumstehenden Rollstuhl, die aus den Abteilungen wohl immer verschwinden, einfach mitnimmt, ohne sie zu fragen. Es kommt zum Streit, ein Hin und Her, mitten im Zimmer vor uns Patient*innen. Doris’ Ärger war nachvollziehbar, hätte sich aber auch an einem anderen Ort entladen können. Nebenan ist der Flur, an dessen Ende ein Balkon. Krankenzimmer mit einem halben Dutzend Krebskranken scheinen in Tageskliniken, zumindest in dieser und für Kassenpatient*innen, ein seltsam öffentlicher Ort zu sein, obwohl es oft um Intimes geht.
Pflegepersonal sollte Machtpositionen reflektieren und wissen, dass Patient*innen manches einfach nicht hören wollen und sollten. Stell dir vor, du bist trans, hast Krebs und kriegst im Krankenzimmer mit, wie sich ein Pfleger abfällig über Geschlechtervielfalt abseits vom dominanten Mann-oder-Frau-Schema äußert. Das geht gar nicht und disqualifiziert jede Pflegekraft.
Die meisten Pflegerinnen in der Tagesklinik scheinen solche Dinge auch zu wissen und danach zu handeln. Es wäre schön, wenn das auch Doris hinbekäme. Vielleicht spreche ich sie doch mal darauf an. ◆
[1] Die Krankenpflegerin Doris bezeichnet sich selbst als „Schwester“, deswegen taucht der Begriff im Text auf. Weil er heute aber von vielen als veraltet und teils auch sexistisch empfunden wird, ist hier meist von Pfleger*innen oder ähnlich die Rede. Zudem sei noch mal darauf hingewiesen, dass der schöne Name „Doris“ hier bloß Platzhalter ist. Ähnlichkeiten zu Personen, die wirklich Doris heißen, wären rein zufällig.
Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man zum Beispiel auf Instagram und per Newsletter:
Zum Autor
Oliver Pöttgen (er/ihm) hofft, dass ihm das Schreiben über die Therapie beim Verarbeiten hilft und es auch für Leser*innen in ähnlichen Situationen eine Hilfe sein kann.
Klingelbeutel
Texte wachsen nicht nur aus Liebe. Es braucht auch Geld. Wer vliestext welches geben will, wirft was in den Klingelbeutel. Der kann PayPal und Ko-fi:
Auch auf vliestext
Überleben in Schwaben
Tsitsi Dangarembga, Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 2021, stellt ihren Roman „Überleben“ in der schwäbischen Provinz vor und stößt an Grenzen. Von Thomas Rahmann.
Merlot und Bolzenschussgerät: Paul Bokowski in Stuttgart
Der Roman- und Lesebühnenautor Paul Bokowski war mit seinem Humor in Stuttgart zu Gast. Von einem Abend, der nachhallt.
Auf der Couch: „Schattenmund“ von Marie Cardinal
Von Psychoanalyse erzählen // In der Reihe „Durch!“ schreibt die Schriftstellerin Sofie Lichtenstein Kurzrezensionen zu Büchern, mit denen sie durch ist.
Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man zum Beispiel auf Instagram und per Newsletter:














